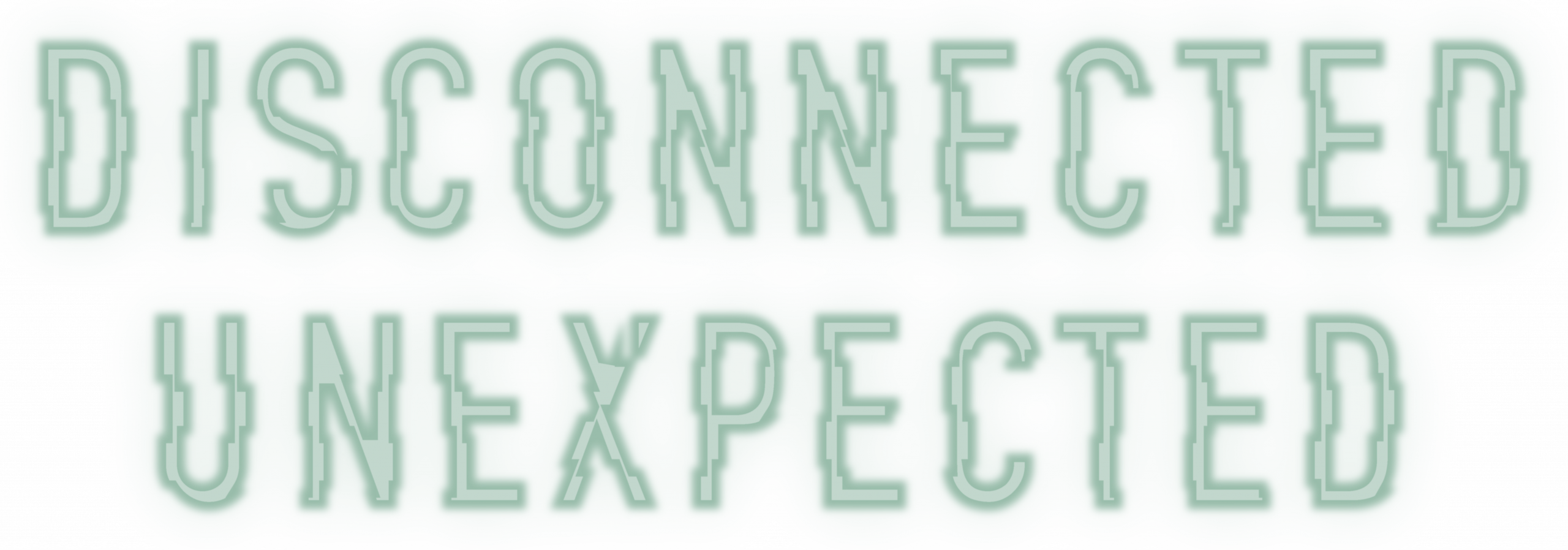Anders als bei vielen klassischen Krisenübungen, die meist nach festen Drehbüchern ablaufen, bietet „Disconnected Unexpected” ein variables Konzept. Die Teams müssen sich ständig auf neue Situationen einstellen, was dazu führt, dass sie ein tieferes Verständnis für Abläufe entwickeln. Das spontane Format sorgt dafür, dass jede Übung einzigartig ist. Durch die fortlaufende Beteiligung des Publikums entsteht zudem ein lebendiger Kreislauf: Vorschläge aus der Community verfeinern das Szenario und die Erfahrungen aus der Übung fließen in künftige Sessions ein. Die Kombination aus Spannung und Lernen macht die Sessions so besonders. Für die teilnehmenden Teams ist es eine ungewöhnliche Art der Vorbereitung, die sich stark von klassischen Schulungen unterscheidet. Jeder Stream wird so zu einem intensiven Lernereignis für alle Beteiligten.
Direkter Nutzen für die teilnehmenden Teams
„Disconnected Unexpected“ bietet den teilnehmenden Notfall- und Krisenteams einen unmittelbar spürbaren Nutzen. Die aktive Moderation steuert das Szenario zielgerichtet, um spezifische Lernziele zu erreichen, die im Voraus festgelegt wurden.
Die Teams trainieren in realitätsnahen Situationen, ohne dass dabei echte Schäden entstehen. In diesem geschützten Rahmen können sie mutig neue Lösungswege ausprobieren und aus Fehlern lernen, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen.
Die Übungen finden unter Live-Bedingungen statt. Dadurch können die Teams ihre Abläufe und Notfallpläne unter Zeitdruck verfeinern und anschließend überprüfen. Durch die aktive Einbindung von Vorschlägen aus der Community müssen die Teams außerdem spontan auf unerwartete Ereignisse reagieren.
Die Moderation fungiert dabei wie eine Spielleitung, die neue Wendungen gezielt einsetzt. Diese dynamische Vorgehensweise erfordert ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. Die Teilnehmer lernen, Prioritäten zu setzen und kreativ zu handeln. Jedes bewältigte „Improvisations-Schock-Erlebnis” stärkt die Fähigkeit, auch in realen Krisen handlungsfähig zu bleiben, und festigt das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit.
Jede Session schließt mit einem moderierten Nachgespräch ab. In diesem Debriefing analysiert das Team gemeinsam mit den Moderatoren seine Entscheidungen, Kommunikationswege und Abläufe. Die Moderatoren sorgen dafür, dass das Nachgespräch konstruktiv verläuft und mögliche Fehler offen angesprochen werden. Dadurch können im Team gemeinsam Verbesserungen erarbeitet werden.
Ein Notfallteam besteht häufig aus IT-Administratoren, Kommunikationsverantwortlichen und Führungskräften. Manchmal wird auch ein Krisenstab simuliert. Die Teams müssen Informationen abstimmen, benötigte Ressourcen anfordern und Entscheidungen gemeinsam vorbereiten. Die Moderation fördert dabei explizit den Perspektivwechsel zwischen den technischen und organisatorischen Rollen. Die Moderation leitet die Übung so, dass IT- und Managementteams eng zusammenarbeiten und sich gegenseitig auf dem Laufenden halten. Dies schärft das Verständnis füreinander und stärkt die bereichsübergreifende Kommunikation.
Die Teilnehmer erleben vielfältige Cybervorfälle in Echtzeit, lernen daraus und stärken direkt ihre Krisenreaktionsfähigkeiten. Zusätzlich stärkt „Disconnected Unexpected” das interne Zusammengehörigkeitsgefühl: Beim gemeinsamen Meistern von Krisensituationen entsteht ein starkes Wir-Gefühl. Es werden alle Teammitglieder – vom IT-Spezialisten bis zum Kommunikationsverantwortlichen – eingebunden, was auch das gegenseitige Vertrauen im Ernstfall fördert.
Vorteile für die Community
Bei „Disconnected Unexpected“ ist die Community ein aktiver Teil des Formats. Zuschauer und Ideengeber werden direkt in die Übung eingebunden, wodurch sich vielfältige Lernchancen ergeben.
Zuschauer können live neue Ereignisse vorschlagen, die unmittelbar ins Szenario einfließen. Durch dieses Mitgestalten lernen die Zuschauern viel über realistische Angriffs- und Krisenszenarien.
Die Moderation wählt passende Vorschläge aus und setzt sie ins Setting um. Erfolgreiche Community-Vorschläge werden dokumentiert, sodass jeder den direkten Einfluss seines Inputs auf die Weiterentwicklung des Formats sieht.
Auf dem Discord-Server und in den Live-Chats tauschen sich Fachleute zu technischen Lösungen, organisatorischen Abläufen und Kommunikationsstrategien aus. So profitieren auch passive Zuschauer von den Übungserfahrungen. Sie erhalten Einblicke in bewährte Verfahren und alternative Vorgehensweisen.
Aktuelle Sicherheitshinweise (etwa vom BSI) werden direkt diskutiert, sodass die Community stets auf dem neuesten Stand bleibt.
„Disconnected Unexpected” bringt IT-Experten aus verschiedenen Branchen zusammen. Mit steigenden Zuschauerzahlen wächst auch die Discord-Community kontinuierlich. Beim Mitdiskutieren knüpfen die Teilnehmer neue Kontakte und stärken ihr Netzwerk.
Durch das Teilen und Kommentieren der Inhalte erhöht die Community die Sichtbarkeit des Projekts. Beiträge auf LinkedIn und Mastodon erreichen Entscheider und IT-Leiter. Führungskräfte erkennen den Mehrwert von Krisentrainings und ermutigen ihre Teams zur Umsetzung. Dadurch gewinnt „Disconnected Unexpected” kontinuierlich neue Teilnehmer und Interessierte.
Über alle Kanäle hinweg entsteht ein offener Dialog. Ideengeber erleben, dass ihre Vorschläge ernst genommen werden. Es entsteht ein Umfeld, in dem alle Beteiligten – Übungsteams wie Beobachter – voneinander lernen und gemeinsam Lösungen diskutieren.
Nutzen für Zuschauer und Beobachter
Auch wer (noch) nicht selbst im Notfallteam mitspielt, profitiert als Zuschauer in hohem Maße: Zuschauer sehen live, wie ein IT-Team mit einem Vorfall umgeht, und können daraus lernen. Viele reflektieren im Anschluss über die eigene Situation: „Kann uns das passieren? Wären wir darauf vorbereitet? Wie würden wir reagieren?” Dieses eigenständige Nachdenken stärkt das Sicherheitsbewusstsein im eigenen Unternehmen.
Das Format ist offen und kostenfrei zugänglich. Jeder mit Internetzugang kann per Twitch oder YouTube zuschauen und sich in den Chats beteiligen. Dadurch können auch kleinere Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen unkompliziert mitmachen.
Die Zuschauer erhalten einen realistischen Blick darauf, wie Incident Response funktioniert. Sie verfolgen, wie Techniker und Führungskräfte miteinander kommunizieren, Prioritäten setzen und Entscheidungen treffen. Diese Einblicke zeigen, welche Abläufe und Informationen in einer echten Krise wichtig sind. Zuschauer können das Gelernte direkt in ihre eigene Organisation übertragen.
Der Live-Charakter und die Interaktivität des Formats schaffen ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Sie können sich über Beobachtungen austauschen und gemeinsam Rückschlüsse ziehen. Jeder Kommentar und das Teilen eines Clips erhöhen die Sichtbarkeit des Projekts. Und je aktiver die Community ist, desto spannender und lehrreicher werden die Übungen.
Alle Sessions werden aufgezeichnet und sind dauerhaft verfügbar. Wer live nicht dabei sein kann, kann sie später nachholen. Auch Unternehmen können die Videos in internen Schulungen einsetzen. Dieser zeitunabhängige Zugriff stellt sicher, dass möglichst viele Menschen von den Inhalten profitieren können.
„Disconnected Unexpected“ bietet Zuschauern eine kostenlose, unterhaltsame und lehrreiche Erfahrung. Komplexe Sicherheitsprozesse werden anschaulich vermittelt. Dadurch erkennen Zuschauer, dass sie selbst Teil der Cyberabwehr sind, und werden inspiriert, sich aktiv um die IT-Sicherheit in ihrem Umfeld zu kümmern.
Übergreifender Mehrwert
Disconnected Unexpected bietet auch über die einzelnen Übungen hinaus einen nachhaltigen Mehrwert.
Langfristig fördert es eine offene Lernkultur im Bereich der IT-Sicherheit. Die Teilnehmenden werden für die regelmäßige Überprüfung von Sicherheitsvorkehrungen sensibilisiert und motiviert. Unternehmen erkennen den Wert dieses Formats und ermutigen ihre Mitarbeitenden zur aktiven Beteiligung. So steigert das Projekt nachhaltig die Cyber-Resilienz: Notfallteams sind besser vorbereitet und es wächst die Bereitschaft, in Krisenvorsorge zu investieren.
Jede Übungssession trägt zum gemeinsamen Wissensfundus bei. Durch die Mischung aus Echtzeit-Simulation und Ideen der Community entstehen immer wieder neue Szenarien und Lernmaterialien. Das Projekt entwickelt sich so zu einem echten Innovationslabor für das Cyber-Krisenmanagement.
Zusätzliche Formate wie die regelmäßig erscheinenden „Deep Dives” erlauben es, besondere Vorfälle mit Experten zu analysieren und festigen so das gesammelte Wissen. Dabei wird etwa alle zwei Wochen ein 45-minütiger Experten-Dialog auf YouTube veröffentlicht, um Hintergründe detailliert zu diskutieren.
Durch das nahtlose Zusammenspiel aller Kommunikationskanäle gewinnt das Projekt kontinuierlich neue Interessenten. Jeder geteilte Beitrag kann ein ganz neues Team auf das Format aufmerksam machen. Zudem sorgen die Algorithmen der Plattform dafür, dass die Sessions fortlaufend anderen IT-Interessierten empfohlen werden. So entsteht ein wachsender Kreis von Unternehmen und Experten, die gemeinsam an der Verbesserung der Cyberabwehr arbeiten.
Die einzigartige Kombination aus Improvisationscharakter und hohem Realitätsgrad schafft ein motivierendes Lernumfeld. Für alle Beteiligten entsteht ein gemeinschaftliches Erlebnis, das gleichzeitig Spaß macht und lehrreich ist. Jeder Beitrag zählt und erhöht den Wert des gemeinsamen Erlebnisses.